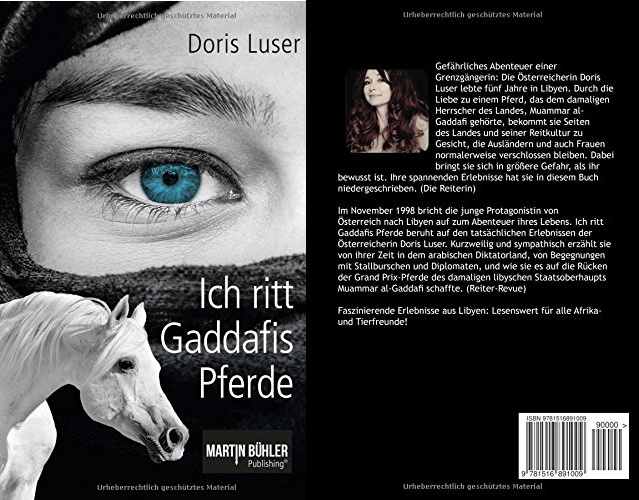Die Texte sind Ausschnitte aus einzelnen Kapiteln im Buch
Dienstag, 10. November 1998
… Urlaubsausflug ist das keiner, das wird mir schnell klar, als ich das Militär sehe vor der Ankunftshalle und einen dicken, gelben Strich am Boden vor der Passkontrolle, nicht mal ein zufälliges Darübertreten wird akzeptiert von dem Herrn in blauer Uniform und schwarzen Schnürstiefeln, mit Barett auf dem Kopf und umgehängter Kalaschnikow. Hier werden Menschen schroff angesprochen. Nur mein Niknak zwingt den Herrn zum zweimaligen Hinschauen und zu einem aufmunternden „Bear has passport?“, als er meine Miene sieht. Ich kann nur den Mund verziehen – Lächeln ist das keines …
Die ersten Tage
„Heute nehmen wir die Autobahn“, sagt der Kollege, „damit du diesen Weg auch kennst!“
Die Autobahn ist genau so verstopft wie die andere Straße, bringt also keinen Zeitvorteil, man sollte es nicht eilig haben, ins Büro zu kommen, es sei denn, man fährt vor sieben Uhr. Aber genau das ist die Zeit, zu der ich noch am besten träume. Ich erwähne beiläufig, dass mein TV-Kabel nicht bis ins Schlafzimmer reicht. Der Kollege singt wieder.
Im Büro beäugt mich die dicke Frau mit dem oriental-romantischen Namen Laila ganz aufmerksam. Ich mag sie schon, und als mir ein Schmunzeln auskommt, will sie mich wieder zerdrücken. Ja, ich fühle mich wohl in ihrer Nähe, weiß sie gerne neben meinem Büro in der Rezeption sitzen und fühle mich dadurch irgendwie beschützt – als würde ich jetzt schon ahnen, dass sie mich eines Tages wie eine Löwin verteidigen wird.
Das Regatta Camp & die Camppferde
Ich sehe schnell, dass die Sättel nicht passen, die Zaumzeuge werden teilweise mit Drähten zusammengehalten, es gibt Druckstellen auf jedem Widerrist, blutige Schürfwunden in den traurigen Pferdegesichtern, verkrustete Risse in den sanften Mäulern, weil die zu scharfen Trensen von unkoordinierten Händen viel zu hart gezogen werden. Von Bandagen oder Gamaschen keine Spur.
Die Kinder schlagen ihre Hacken in die Bäuche der armen Kreaturen, und wenn eine sich wehrt, läuft Mohammed auf sie zu mit einer langen Longiergerte in der Hand, in der anderen Hand eine glühende Zigarette. Er gibt den spanischen und arabischen Kindern Reitunterricht – so verläuft hier ein Samstagnachmittag für reitbegeisterte Familien. Ich warte nicht, bis Mohammed fertig ist mit seinen sportlichen Erklärungen, sondern verschwinde in der Menge der stolzen Eltern, die am Rand des Reitplatzes ihren Sprösslingen freudig zusehen.
Um mich zu trösten, kehre ich in den Minisupermarkt ein, um mir die Marzipanschokolade zu kaufen oder besser drei davon. Mit „Frustfressen“ hat das allerdings nichts zu tun. Wie schon gesagt: Ich esse einfach nur gern.
Abwechslung scheint kein verbreitetes Wort hier zu sein, denn so wie gestern lehnen dieselben, arrogant gelackten Burschen in Designer-Jeans an ihren Luxusautos und unterhalten sich angeregt über ein sicher überaus wichtiges Thema, zumindest tun sie so. Fünf undefinierbar gefärbte Katzen springen plötzlich wie eine Fontaine und klagend aus der Mülltonne auf die Straße, das vorbeifahrende Auto bremst nicht, aber die Katzen haben Glück.
Heute, denke ich deprimiert. Ich versuche sie anzulocken und beuge mich hinunter, sie glotzen mich aber nur an mit schmutzigen Gesichtern und laufen in die entgegengesetzte Richtung davon.
Joe und der Umzug ins „Seaview”
Heute Abend bin ich eingeladen zu einem Tauchertreffen. Die Froschmänner und –frauen treffen sich regelmäßig, obwohl Tauchen in Libyen verboten ist beziehungsweise nur vom Regatta-Strand aus erlaubt ist. Ich nehme einen Expatriate-Kollegen mit, denn erstens zwinge ich ihn zu fahren, zweitens will er tauchen lernen und drittens habe ich herausgefunden, dass es besser ist, in bekannter Begleitung aufzukreuzen, denn da kann ich mich mehr dem Essen widmen als langweiligem Small Talk. Zur Besprechung und Vorstellung kommen wir deswegen gewollt zu spät, aber genau rechtzeitig zur Buffeteröffnung.
Während des Essens beobachte ich eine Gruppe junger Leute, denen ich sicher schon einmal begegnet bin, ich kann aber nur eine adrette, auftoupierte Blondine zuordnen: eine Deutsche, die heftig und eindeutig mit einem Tunesier flirtet. Soviel ich mitbekommen habe, ist sie aber verheiratet. Vermutlich ist ihr Mann nicht da. Egal, geht mich nichts an. Ich schiebe mir noch eine Minifrühlingsrolle in den Mund, als mich jemand von hinten anredet. Verblüfft drehe ich mich um: Da ist er ja – der Ehemann der Blondine!
Aha, überlege ich, jetzt will er mich als Retourkutsche benutzen, freue mich aber, im Dialekt mit dem Bayern zu sprechen und stelle im Gespräch fest, dass der nicht recht zu dieser Frau passt, denn er wirkt angenehm sympathisch und gar nicht eifersüchtig, weil er seine Frau überhaupt nicht beachtet. Außerdem ist er so richtig locker drauf, auch das Essen schmeckt ihm.
„Sehr interessant! Vielleicht bin ich in einen Swingerklub gelandet mit Decknamen Tauchertreffen“, amüsiere ich mich heimlich, und als mir Joe auch noch seine Nummer aufschreibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Vermutung richtig ist.
Trotzdem rufe ich ihn schon nach ein paar Tagen an, weil ich starke helfende Hände brauche für meinen Umzug vom Alcatraz ins „Seaview“ – denn so habe ich die Wohnung, „in der man das Meerrauschen im Schlafzimmer hören kann“, schon getauft.
Ich habe meinen Chef überzeugen können, dass ich unbedingt dorthin ziehen muss – trotz wiederholter Einwände unserer Sicherheitsangestellten, dass die Wohnung zu weit weg sei von den anderen Firmenwohnungen, und diese Gegend zu gefährlich sei für eine alleinstehende Frau, weil das Arbeiter-Wachmänner-Wohnhaus gleich gegenüberliegt und es wiederholt Einbrüche in Frauenwohnungen gegeben habe, und das Seaview nicht vergittert sei. Außerdem gehöre die Wohnung darunter einem der alten Revolutionäre – Abdusalam Djalloud. Und so weiter und so fort …
30. Geburtstag und ein
libyscher Wüstenhund in „Leptis Magna“
Am Morgen erwache ich bei Vogelgezwitscher und Meerrauschen, die Sonnenstrahlen zwängen sich schon durch den Vorhang. Ich rekele mich unterm Moskitonetz und denke, dass ich jetzt das Alter erreicht habe, in dem sich sogar in Libyen Begleitschutz erübrigt. Ob sich wohl über Nacht zum Dreißiger was verändert hat? Nein, stelle ich fest, es tut nichts weh!
Kevin ist wieder auf Durchreise in Tripolis, und ich habe von der Arbeit freigenommen, denn wir wollen einen schönen Tag in der phönizisch-römischen Ruinenstadt „Leptis Magna“ verbringen. Nach über einer Stunde Fahrens gen Osten sind wir am Ziel, und als wir in eine Parklücke reinfahren, sehe ich etwas Braunes unterm Auto verschwinden. Ich springe raus, knie mich hin und sehe nach. Da sitzt doch tatsächlich ein kleiner Hund unter dem Auto und knurrt mich gefährlich an. Ich muss lachen und sage mehr zu mir selbst als zu Kevin, aber bestimmt, dass ich keinen Hund will. Kevin sieht mich fragend an und sieht jetzt auch den Welpen, der unter dem Auto hervor kommt und uns neugierig anschaut. Allerliebst schaut der kleine Kerl aus mit seinem weißbraunen, struppig verfilzten Babyfell, das weiße Schwänzchen mit brauner Quaste steht kerzengerade in die Luft, und trotz seiner Winzigkeit fallen mir sofort seine langen Beine und die geknickten Ohren auf, urkomisch ist er anzusehen – wie ein Komik-Wollknäuel auf Stelzen. Auch um Kevin ist es geschehen. Ich kann mich nur schwer von dem Hund trennen, der unbedingt mit mir spielen wil, aber Kevin hat schon Eintrittstickets gekauft, und durch den Hadrianbogen betreten wir die Altstadt, den „Traum des Kaisers”.
Leptis Magna übertrifft fast noch die Metropole Sabratha mit einer riesigen Thermenanlage, in der man neben Massageräumen und Saunen auch schon Rohrleitungssysteme für Klos findet. Von der bunten Marmorverkleidung können wir nicht mehr viel sehen, denn die wurde brutal abgestemmt. In der Ruine der Severischen Basilika (ein dreischiffiges Gebäude zur repräsentativen Funktion) halten wir uns die längste Zeit auf, denn auf Rosengranitsäulen kann man die zwölf Taten des Herkules bewundern. Dann steigen wir die fast tausendfünfhundert Jahre alten Stufen der Empore hinauf. Von da können wir einen atemberaubenden Blick über die gesamte Ruinenstadt und das Meer genießen. Ich sage gedankenverloren, dass ich hier keinen Hund brauchen kann, denn der spukt mir die ganze Zeit im Kopf herum.
Beim Hinausgehen ein paar Stunden später frage ich mich, ob der kleine Bursche noch da ist, und tatsächlich sitzt er mitten in einem umgefallenen Müllcontainer und knabbert an einer Eierschale – das scheint sein Zuhause zu sein! Als ich ihn zum Abschied hochhebe und die Rippen und das aufgeblähte Bäuchlein spüre, bedeutet der auf einem Plastiksessel herumsitzende Kassamann beim Altstadteingang mit einer ausschweifenden Handbewegung, ich solle ihn mitnehmen. Mit einer altbekannten Gebärde macht er klar, dass seine Mama wohl tot ist und er es auch bald sein wird. Er reicht mir ein rosa Plastiksäckchen, um den Hund reinzupacken.
Ich verabschiede mich von dem netten Herrn und dem Hündchen. Wir fahren zurück nach Tripolis, um rechtzeitig bei einer AUA-Feier im modernen Grand Hotel „Kebir” dabei zu sein, natürlich gibt es bei so einer Gelegenheit immer ein reichhaltiges Buffet. Selbst dort kann ich den Hund nicht vergessen, aber da ich schon am Donnerstag nach Hause fliege, und Kevin weiter zur Bohrung in die Wüste reist, gibt es keine Chance für den lieben Kerl, nach Tripolis zu kommen.
Gadjo und eine
spritzige Jetski-Fahrt in Regatta
Nach zwei wunderschönen Wochen zu Hause komme ich donnerstags zurück. Es ist zwar wieder ein Nachtflug, aber es ist gut, direkt in Tripolis zu landen und gleich danach „daheim” zu sein, und nicht erst eine weitere Reise zu beginnen ab Djerba. Im Gepäck habe ich viele Hunde-Utensilien und jede Menge Ratschläge vom Tierarzt daheim. So der erste: „Oje, lass den Afrikaner ja dort, wo er hingehört!“
Gadjo, den ich bei einem Besuch auf der Bohrung in der Wüste geholt habe, ist in den letzten Wochen ein ganzes Stück gewachsen. Zurück nun in Tripolis, passt er nicht mehr in seine Schachtel, und weil ich nicht weiß, wie groß er wird, schläft er derweil im Bett neben mir, und bald kriege ich für Gadjo einen Gartenzaun rund um mein Seaview. Es gefällt uns, am frühen Abend durch das Camp zu spazieren. Ich versuche, Gadjo ein bisschen Benehmen beizubringen, aber das nimmt er nicht so genau, und ich eigentlich auch nicht. Außerdem ist er ständig hinter mir her, so erübrigt sich die Leine, und das mitgebrachte Halsband ist ihm auch sehr unangenehm. Am schlimmsten ist es für Gadjo, wenn ich schwimmen gehe, zwar nicht lange und weit, weil es mir noch immer zu kalt zum Schwimmen ist – aber immerhin. Aufgeregt läuft er am Strand hin und her und bellt und weint, bis ich wieder raus komme. Dann ist die Freude groß! Fast gestorben vor Schreck wäre mein Hund aber, als ein paar Jetski direkt auf uns zuhalten und dann im letzten Moment ausweichen, als sie uns beide schon völlig nass gespritzt haben. Statt mich zu ärgern, überkommt mich eine gewaltige Lust auf so ein Wassermotorrad: Ich winke und hüpfe wie ein Gummiball auf und ab am Strand. Ich muss so urkomisch aussehen in meinem neonorangen Badeanzug, dass tatsächlich einer kehrt macht und mir hinter sich den Platz anbietet. Den will ich aber nicht, ich will selber fahren, und da er mich anscheinend nicht versteht, dränge ich den in seiner Sicherheitsweste etwas dicklich aussehenden, verdutzten Typen mit den langen, nassen Haaren zurück und verschaffe mir somit Platz. Los gehts! Schließlich mache ich das nicht das erste Mal, das kriegt der Bursche hinter mir zu spüren, der Arme weiß nicht, wo er sich festhalten soll. Heißa! Es macht mir irre Spaß, ich denke weder an Gadjo, noch an die anderen Jetskifahrer, die jetzt versuchen, neben mir zu fahren, noch an den Kerl hinter mir, selbst das kalte Wasser spüre ich nicht. Selbst dann nicht, als wir in einer zu eng genommenen Kurve umkippen. Ich tauche lachend wieder auf und mein Begleiter bietet mir wieder den Fahrerplatz an, aber ich bitte ihn, mich zum Strand zurückzubringen. Er fragt mich noch nach meinen Namen und verschwindet, als Gadjo ihn böse anknurrt.
Besuch im Schönheitssalon
Nach Susis Bemerkung über meine Haare beschließe ich, mit dem Friseurbesuch nicht auf Zuhause zu warten, sondern hier vor Ort die Sache anzugehen, denn entgegen den europäischen Schönheitsratgebern wachsen meine Haare durchs Meerwasser wie Unkraut. Und die von der Sonne ausgebleichten Spitzen zu schneiden, kann auch nicht schaden – so bleibe ich auf dem Nachhauseweg vom Büro bei einem Bungalow gleich an der Straße nahe dem Regatta-Camp stehen, wo ich eine schwarze Schere und ein schwarzes Auge auf rotem runden Hintergrundschild aufgemalt sehe. Hier muss ich richtig sein!
Ein paar Treppen gehts hinauf in einen angenehm klimatisierten Empfang mit dem typisch würzigen Weihrauchgeruch, wo mich ein paar Frauen ohne Schleier empfangen – und kein Englisch sprechen. Also mache ich mit Fingerdeuten und Scherenfinger auf meine Haare klar, was ich brauche. Neugierig sehe ich mich um: Es gibt hier lauter Nebenräume mit Vorhängen davor, die vor Blicken schützen sollen. Ein entzücktes und etwas zu lautes „Aaah“ zeigt mir, dass die Frauen verstanden haben, was ich wünsche, und führen mich in einen abgetrennten Raum, wo wie von der Zeit vergessene Waschtische stehen, und mich eine weitere stark geschminkte, adrette Frau nicht gerade freundlich mit „ga’mez lotha“ (setzen!) auffordert, Platz zu nehmen. Aber so eine Waschprozedur brauche ich nicht und sage mit meinem bisschen bereits erworbenen Arabisch „mafisch moya“, was soviel heißt wie „das Wasser ist weg“, und meine damit: „Bitte nicht waschen!“ Erstaunt und fragend schauen mich die beiden Friseurinnen an, beratschlagen erneut arabisch miteinander, und ich stehe grinsend, mich neugierig umsehend, da. Sie haben verstanden, denn als Nächstes werde ich auf einen weißen Plastiksessel gesetzt. Mit den Fingern streicht eine über mein welliges Haar und deutet mit dem Handrücken auf halb, mittel, und lang. Ich zeige mit zwei Fingern ungefähr fünf Zentimeter und dabei entwischt ihr wieder ein wissendes „Ah!“ Mit Seitenblick auf ihre Kollegin, die geschäftig nickend zusieht, bindet sie meine Haare, ohne sie zu kämmen, zu einem Pferdeschwanz zusammen, nimmt die Schere und schneidet ein gutes Stück Länge ab (jede Art von Angaben scheint hier permanent ignoriert zu werden), was sogar bei meinem fast hüftlangen Haar einiges ausmacht!
Mittlerweile stehen ungefähr acht Frauen um uns herum: Vom Kindergartenmädchen bis zur Oma, noch immer ist keine verschleiert, und alle sehen recht gepflegt aus. Ich bin zwar nicht zimperlich, schon gar nicht mit meinen Haaren, aber ein bisschen radikal finde ich diese Methode schon, die Friseurin lässt jetzt die Haare wieder auseinanderfallen. So schlecht sieht das Ganze gar nicht aus, nur vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig; ich muss lächeln, als ich mir das Gesicht meiner Friseurin daheim vorstelle, hätte sie das gesehen.
Alle Frauen reden jetzt durcheinander, und ein paar deuten auf mich, aber so locker westlich, wie sie angezogen sind, nehmen sie jetzt sicher keinen Anstoß an meiner Kleidung. Also lasse ich mich von allen Seiten begaffen. Mein Blick fällt auf die rostrote Bemalung auf beiden Händen einer Frau, ich deute darauf und alle schreien auf einmal los.
„Henna henna, nam henna volahi! Tibbi henna? Masbud, hadi tibbi!“
Njusch
So komme ich also aufgekratzt nach Hause zu meinem Gadjo, der wie immer schwanzwedelnd und freudig auf mich wartet. Ich muss das Zeug von meinen Lippen runterkriegen, die mittlerweile aufgeschwollen sind wie bei meinem braunen Wachmann (auch im dezenten Blaumann gekleidet, mit unausweichlicher Wollmütze, seine in Jamaikafarben – ich glaube, die schlafen alle damit), der Spaß daran hat, Gadjo bei seinen Rundgängen verrückt zu machen, indem er mit dem Baseballschläger über den Gartenzaun rattert. Ich habe ihn mal dabei erwischt und mit erhobenem Zeigefinger gedroht, das nicht zu tun: Nicht auszudenken, was geschieht, wenn ich mal „unabsichtlich” die Gartentür offenlasse … Ich bin mir aber nicht sicher, ob er mich verstanden hat. Abgesehen davon weiß ich nicht, wem er mit dem Schläger Angst einjagen will.
Also rein ins Bad, wo sich mittlerweile die Wäsche türmt in der Ecke hinter der Tür – denn Esther hat mich verlassen, um zu ihrer Familie nach Eritrea zurückzukehren. Leider kann ich jetzt gar nichts machen gegen diese Lippenschwellung, nur hoffen, dass sie über Nacht zurück geht und Gadjo auf den Abendspaziergang verzichtet.
„Wenn mich jemand so sieht, kriegt er Angst“, lache ich jedoch übermütig und stecke mir die eingeölten Haare hoch, die aussehen, als hätte ich sie wochenlang nicht gewaschen. Den Blick in den Spiegel hätte ich mir besser erspart, denn schon gibt meine innere Stimme ihren Senf dazu: „Du schaust aus wie ein Vampir auf Aufriss.“
„Aber warum verwenden die dieses Zeugs hier“, frage ich mich, „sind doch alle brav und züchtig, islamisch halt. Hm?“
Darin liegt eindeutig wieder eine Doppelmoral, aber weitere Gedanken mache ich mir darüber jetzt nicht, weil ich von draußen Geschrei und Gejohle höre, darum augenblicklich meine Lippen vergesse und mir das Spektakel ansehen will. Unten laufen kreischend die drei stets schmutzigen, griechischen Kinder von Gegenüber mit einem dunklen Stofffetzen herum, den sie am Zipfel packen und herumwirbeln. Komischerweise jammert der Fetzen, und bei genauerem Hinsehen kann ich es kaum glauben: Es ist ein Kätzchen, das sie am Schwanz gepackt haben und im Kreis durch die Luft schleudern! Ich staune nicht schlecht über mich selber, wie gut ich auf einmal griechisch spreche (die Lautstärke ist da sehr ausschlaggebend) beziehungsweise schreie. Erstaunt halten die drei Kinder inne, und das Katzenbaby fällt auf den Betonboden. Da bin ich auch schon unten bei ihnen, und wenn ich nicht so auf das kleine Ding fokussiert wäre – jetzt wäre mir fast die Hand ausgerutscht. Aber ich ignoriere die Drei, die wortreich auf mich einschreien, und hebe die dreckige, kleine, graue Katze auf – sogleich bin ich voller Blut. Von ihrem Hals bis zum Schwanz klafft eine stark blutende Wunde am Rücken. Die Katze hat aufgehört zu jammern. Gadjo ist auch aufgeregt von dem Lärm, geht keinen Schritt weg von mir und begleitet mich die Treppen hinauf, sogar mit hinein in die Wohnung, und das macht er nicht oft und nicht gerne, nur, wenn Besuch da ist. Ich weiß nicht, was ich mit der Katze jetzt anfangen soll, halte sie nur ganz behutsam fest und flüstere ihr zärtliche Worte ins winzige Ohr, wohl um mich selber zu beruhigen.
Das „System” und ein Samstag
im Skanzka Camp
Fast noch mitten in der Nacht, so kommt es mir jedenfalls vor, reißt mich lautes Hupen und das darauffolgende Gebell von Gadjo aus meinen Pferdeträumen. Sandy und Joe kommen schon zum Frühstück, bevor wir zum „Skanzka Camp“ zum Schwimmen gehen. Sie bringen Weißwürste und selbst gebackene (!) Laugenbrezen mit, ich muss nur noch den Kaffee und Milchschaum zubereiten und Eier kochen.
Ich erzähle den beiden aufgeregt von meinem Pferdeerlebnis und von Neaba. Sandy hört interessiert zu und unterbricht meinen fast romantischen Redeschwall ab und zu mit zynischen Kommentaren über die dort herrschenden Sicherheitsmaßnahmen. Joe ist mit den Würsten beschäftigt, da es geht ihm wie mir, wenn ich Hunger habe: Wenn die Scherenhände durch den Magen fahren, sind wir unfähig, noch irgendetwas aufzunehmen. Macht nix, denn er wird von mir heute nichts anderes mehr hören! Njusch ist in seinem Element: Er klettert Sandys luftiges Sommerkleid rauf und runter und schnurrt dabei mit der Lautstärke eines Tigers, und sie streichelt gedankenverloren über seine langen weißen Haare, die ihm auf der Rückennarbe gewachsen sind. Selbst Gadjo wuselt in der Wohnung herum, wenn Besuch da ist. Unter Lachen decken wir den Tisch hier drinnen, da es am Balkon zu heiß ist. Hans ist auch schon im Anmarsch und streckt uns von unten seine Hände entgegen mit jeweils einer Flasche Veuve Cliquot. Er ignoriert den schwarzen Watchman, der am Gassenanfang im Schatten eines Oleanderstrauches hockt und ihn mit großen Augen nachschaut.
Joe und Sandy machen sich lustig über Hans’ Unbekümmertheit und beginnen uns zu erzählen von einer noch gar nicht langen Zeit vor meiner Ankunft im Land.
„Da wurden sogar Expatriates eingesperrt oder des Landes verwiesen, wenn sie mit ‚Whisky‘-Flaschen erwischt wurden, und es wurden Wohnungen kontrolliert, ja sogar Autos durchsucht. Nächtliche Strandspaziergänge in Regatta waren verboten, Expats auf der Straße und in Autos wurden vom Geheimdienst und Polizei aufgehalten und auf Dollarbesitz untersucht!“
Seit die Vereinten Nationen das Luftembargo über Libyen im Jahre 1992 verhängt haben, sind Dollarnoten „haram”, also schlecht, grauslich, unheilig und somit absolut verboten. Auf dem Schwarzmarkt wird aber ordentlich damit gehandelt, genauso wie mit Whisky (die Flasche kostete damals neunzig US-Dollar und in meiner Tiefkühltruhe lag somit ein Vermögen aus Ottos Hinterlassenschaft). Man lügt sich also auch hier gewaltig in die Tasche. Wir erwähnen dabei den uns allen bekannten ägyptischen Fensterputzer Farid in den Towers, der fast täglich – im selben Blaumann – seine Nase in unsere Büros rein steckt und dezent nach „change money“ fragt, dann die Dollars sich hastig umblickend in Zeitungspapier wickelt und schnell einsteckt. Ich muss schmunzeln, als ich an die in meinen Schuhen geschmuggelten Geldnoten denke. Während des leckeren Frühstücks reden wir von den Ermahnungen unserer Firmen und Kollegen, niemals den Namen Gaddafis am Telefon zu erwähnen, sonst würde die Leitung augenblicklich unterbrochen werden. Alle Telefonate werden sowieso aufgezeichnet, Faxe natürlich ebenso. Auch mit dem Mailverkehr und Internet, das gerade erst vor knapp einem Jahr im Land eingeführt wurde (und nie einwandfrei funktioniert, sonst hätte ich schon längst den Raketen-Lutz gegoogelt), muss man sehr vorsichtig sein, wirft Hans ein: „Jede aufgerufene Seite wird nachverfolgt, sehr viele sind beschränkt, jede Mail wird registriert!“
Mein „Urban Horse” kommt
Endlich, endlich bekomme ich von der Botschaft die Nachricht, dass der Transporter mit dem nagelneuen Jeep des Botschafters und meinem alten Motorrad in Djerba angekommen ist, dort umgeladen wird, um dann verplombt über die Grenze nach Libyen zu gehen, wo ich mir mein Motorrad übermorgen an der österreichischen Residenz abholen kann. Ich kann kaum noch still sitzen, als ich die Nachricht höre!
So weit, so gut. Fast zu unkompliziert, um es glauben zu können. Leider ist gerade dieser diplomatische Transport mit meinem Motorrad der erste in der libysch-österreichisch-diplomatischen Geschichte, von dem die Plombe an der tunesisch-libyschen Grenze wieder entfernt wird, um den Inhalt zu kontrollieren. Dass der Transporter nicht nur in Libyen nicht erlaubte Fahrzeuge enthält, sondern auch allerlei verbotene Spirituosen, kann man gleich am nächsten Tag aus den österreichischen Nachrichten und Zeitungen erfahren. Mir teilt es sofort telefonisch der aufgeregte Hans mit: „Der Botschafter ist schon auf dem Weg zur Grenze, um die Sachlage zu überprüfen und um zu retten, was zu retten ist.“
Langsam lege ich den Hörer zurück aufs Telefon. Nein, nein, nicht, dass ich kein Vertrauen in die diplomatische Redekunst meines Botschafters mit dem Protokoll hätte, aber ich glaube leider, dass ihm mein Motorrad nicht so sehr am Herzen liegt wie mir. Ich kann jetzt nichts machen, als abzuwarten.
Hans kommt am Abend bei mir vorbei und erzählt mir vom Misserfolg der Verhandlungen.
„Das Auto, das Motorrad und der Alkohol befinden sich nach wie vor an der tunesisch-libyschen Grenze in einer großen Lagerhalle. Alle anderen Dinge, wie ein paar Möbel, Nahrungsmittel und nichtalkoholische Getränke, sind schon in Tripolis angekommen.“
Jetzt brauche ich eine Zigarette, wenn ich an meine Yamaha denke, die sich allerdings in bester Gesellschaft des diplomatischen Jeeps befindet. Meine Gedanken rattern, mein Hirn schwillt schon fast an, das kann sogar Hans sehen. Ich krame meine Perlenabendtasche hervor und halte Hans die Visitenkarte von Khalil unter die Nase, dem Typen, den ich am Opernball durch Monika und Haris kennengelernt habe. Hans kriegt große Augen, als er den Namen auf der Karte sieht, schluckt und herrscht mich an: „Warum hast du mir nicht schon vorher von ihm erzählt? Weißt du überhaupt, wer der ist?“
„Ja“, gebe ich überaus wichtig zu, „Haris hat mir von ihm erzählt. Aber was spricht denn dagegen, wenn ich ihn um einen Gefallen bitte? Schließlich hat er mir angeboten, dass ich mich jederzeit an ihn wenden soll, wenn ich etwas brauche im Lande.“
Und da der elegante Typ das sicher nicht zweideutig gemeint hat, greife ich auch schon zum Telefon, und Hans legt gleich seine Hand auf meine.
„Warte wenigstens noch ein bisschen“, meint er, „lass uns noch andere Möglichkeiten besprechen.“
Wir sprechen und sprechen, überlegen hin und her, trinken zwei Flaschen südafrikanischen Rotwein mit Joes Hilfe aus, der, schon neugierig auf mein Moped, vorbeikommt (sadistischerweise kommt er mit seinem Motorrad), und Njusch sich wie immer sofort auf ihn stürzt: Er liebt Joe heiß und weiß nicht, dass dieser gegen ihn allergisch ist. Aber selbst nachdem wir mit schon lauwarmem Wodka erst auf unsere Freundschaft, dann auf unsere Mütter, auf meine Zimmerpflanze und auf unsere Leber anstoßen, der Aschenbecher längst keine Zigarettenkippe mehr aufnimmt, und wir mit all dem Alkohol in unseren Gehirnzellen mein Motorrad bei Nacht und Nebel (hoppala, den gibts hier ja gar nicht), also bei Nacht und Gibbli als Ninjas verkleidet ins Land schmuggeln und uns vor Lachen nur noch zerkugeln – haben wir noch keine wirklich brauchbare Lösung gefunden. Dafür aber einen Spruch, und der geht so:
Piff Paff ist die neue Masche, Piff Paff passt in jede Tasche!
Piff Paff wirkt ganz zauberhaft – hat alles außer Kakerlaken hingerafft!
Soll Achmed einmal länger bleiben, musst ihn halt mit Piff Paff treiben!
Wirds im Souk mal schnell zu teuer, mach ihm doch mit Piff Paff Feuer!
Wirds dir beim Zoll einmal zu toll – mach den Whisky mit Piff Paff voll!
Selbst gegen Aischas Kinderschar wirkt das Mittel wunderbar!
(Anmerkung: Piff Paff ist dieses Ungezieferspray, das tatsächlich so heißt!)
Erster Ritt auf Neaba
An Freitagen kommt Gadjo mit zum Stall und lernt dort den Umgang mit den Pferden, und die Stallburschen lernen den Umgang mit ihm, was so manches Mal zu Aufregungen führt, denn Gadjo lässt sich nicht verscheuchen wie ein Streuner. Wenn jemand Steine nach ihm wirft, geht er in Angriffstellung und klemmt nicht winselnd den Schwanz ein und rennt weg.
Während Najat und ich reiten, balgt Gadjo mit den streunenden Hunden herum, dabei verschwindet er mit ihnen in das kleine Wäldchen hinter dem Reitplatz, ist aber sofort wieder bei mir, wenn ich ihn rufe, und das mache ich immer, wenn ich vom Pferd steige. Gadjo sieht, dass ein Pferd kein Ungeheuer ist, dem man nachjagen muss, obwohl er das naturgemäß bei einem arabischen Rappen versuchte, der auf der Koppel stand beziehungsweise lief. Was natürlich folgte, war eine ordentliche Standpauke meinerseits und dann noch eine und wieder, aber mittlerweile sieht er ein, dass es mir ernst ist hier bei den Pferden, und er sich daran unweigerlich halten muss.
Nach einiger Zeit unserer Bekanntschaft stellt Najat mich ihrem Chef (und zukünftigen Ehemann) vor: General Faris – ich schätze ihn auf sechzig Jahre – ist seit dreißig Jahren in erster Linie Chef von Forusia, in weiterer Linie einer von Gaddafis Revolutionären. Was man da noch für Verpflichtungen und Aufgaben hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß jetzt, dass der weiße Wagen vor dem Halleneingang ihm gehört, und nachdem er sich von seinem Büro oben in der Halle vergewissert hat, dass ich nicht so schlecht reite, und Najat ihm gesagt hat, dass ich recht hartnäckig bin, mich nicht abschütteln lasse und auch immer wieder komme (im Gegensatz zu manchem Team-Reiter), hat er eingewilligt, dass ich Neaba „moven” darf. Und unter „bewegen” könnte man auch „reiten” verstehen, NICHT WAHR?
Um das auszuprobieren, ist abermals Freitag der beste Tag, weil da eben keiner da ist, und ich völlig uneingeschränkt mit Neaba sein kann. Gadjo hält mir die Stallburschen vom Leib, und ich schleiche mich, für diesen Zweck mit einem aus Österreich mitgebrachten Sattel, in seine Box und lasse ihn daran riechen. Der Sattel muss verdammt gut riechen, denn das Pferd will gar nicht mehr aufhören damit und schnuppert noch daran, als er schon längst auf seinem Rücken festgebunden ist. So einfach war das, aber natürlich benutze ich für außergewöhnliche Situationen auch einen geheimen Trick: Neaba ist ganz wild auf Gummibärchen! Da ich mit denen aber stets Ärger am Zoll habe („Haram! It contains pork!“ Jaja, in Gummibären ist Schweinegelatine enthalten), muss ich sparsam damit umgehen, und Neaba bekommt nur eines, wenn er ausgesprochen brav ist, oder ich ihn, wie heute, bestechen muss. Ich lege ihm noch die weiche Gummitrense an, und nun brauche ich doch Abdul – um die Halle aufzusperren und das Pferd eventuell zu halten, während ich aufsteige. Deshalb bitte ich ihn, mit mir zur Abreithalle zu kommen. Abdul schüttelt nur wortlos den Kopf, als er mein Vorhaben sieht – und geht kopfwackelnd mit.
Diesmal nehme ich Abduls Aufsitzhilfe an und lasse mich ganz sacht in den Sattel gleiten – halten darf er Neaba aber nicht. Ich muss zugeben, mein Herz klopft ein bisschen schneller als normal, aber er wurde ja schon geritten, beruhige ich mich selber. Sofort marschiert Neaba los, noch bevor ich die Zügel aufnehme. Ich gebe ihm die Richtung an, der er willig folgt, obwohl er keine Beinhilfen kennt. So drehen wir im Schritt unsere ersten, keineswegs entspannten Runden in der kleinen Halle, aber langsam fühlen wir uns beide sicherer. Ständig kraule ich seinen Mähnenansatz und spreche mit ihm, seine kurzen Ohren beweisen mir, dass er genau zuhört! Als sich Neaba im Schritt einigermaßen gut dirigieren lässt, und auch ganz langsam meine Schenkelhilfen akzeptiert, versuche ich, ihn anzutraben. Er bricht sofort aus und stürmt los, aber ich kann ihn sogleich wieder beruhigen, und nach noch ein paar Runden ruhigen Schritts, versuchen wir es noch einmal: Und diesmal klappt es mit dem Traben, obwohl er eilt wie der Zappelphilipp und immer wieder in stürmischen Galopp fällt. Also lasse ich es für heute einmal gut sein, gebe ihm ein Gummibärchen, befreie ihn von Sattel und Zaum und lasse ihn alleine in der Halle seine Runden machen.